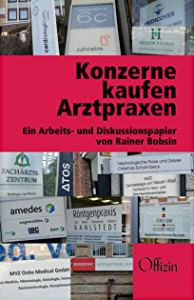30 Jahre in die Zukunft
Die politische Debatte um die MVZ und dem durch sie verkörperten Wandel der ambulanten Strukturen wird ohne Frage auch in den nächsten Jahren spannend bleiben. Denn der ambulante Sektor ist hinsichtlich seiner Strukturen immer noch im Fluss. Teilweise handelt es sich um eine Generationendebatte, die sich im Laufe der Zeit selbst überholen wird. An anderen Stellen geht es um Strukturveränderungen, die ohne aktives Eingreifen des Gesetzgebers oder der Ärzteschaft nicht allein passieren. Hier wird der Konsens zwischen Ärzten, Politik und Gesellschaft beständig neu verhandelt werden müssen.
Auch heute noch werden MVZ als Sinnbild der Veränderung in der Gesundheitspolitik wahrgenommen. Diese Veränderung ist, wie auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen, nicht allen recht, weshalb der Widerstand auch gegen MVZ weiter anhalten wird. Im Herbst 2022 wurde die Debatte um die MVZ neu entfacht, nachdem sie durch die Corona Pandemie zunächst in den Hintergrund gerückt war. Die Forderungen bezüglich der Regulierung der MVZ, zum Beispiel durch die Einschränkung der Zulassung von nicht-ärztlichen Trägern oder Beschränkung auf Regionen mit einem hohen Bedarf an medizinscher Versorgung. Dadurch besteht in der gegenwärtigen Debatte für MVZ ein neuer Grad an Unsicherheit hinsichtlich der langfristigen Entwicklungsperspektive. Mit der Legislaturperiode der Ampelkoalition und dem Amtsantritt von Karl Lauterbach dynamisierte sich die Debatte um die MVZ.
Insbesondere rückten ‚Investoren-MVZ‘ in den Mittelpunkt, wobei zu keinem Zeitpunkt der Diskussion Klarheit darüber herrschte, wer denn mit ‚Investoren‘ gemeint sei. Im Sinne der Wortdeutung investiert auch der Einzelarzt in seine Praxis. Folgt man der Argumentation der MVZ Widersacher, lässt sich diese Interpretation des Begriffes Investor aber nicht mit dem Berufsverständnis der Ärzteschaft übereinander bringen. Öfter wird der Investor-Begriff auch mit so genannten Privat Equity Gesellschaften assoziiert. Privat-Equity, kurz PE, ist ein Sammelbegriff aus der Finanzwirtschaft, zu dem es allerdings auch keine einheitliche Definition gibt. Noch 2012, im Nachgang der Finanzkrise, scheiterte die EU im Rahmen der Reglementierung der Finanzbranche an einer Definition der PE.
Fakten als Basis für politische Entscheidungen
Der freie Autor Rainer Bobsin gibt in seinem “Arbeits- und Diskussionspapier” einen sachorientierten Einblick in die komplexen Zusammenhänge des MVZ-Marktes, erklärt, warum nicht in jedem Fall bekannt ist, wem welche Praxis gehört, und beschreibt die Entwicklung des Arztpraxenmarktes seit 2004 sowie die aktuelle Debatte über die Zukunft Medizinischer Versorgungszentren. Insgesamt wirft er einen konzentrierten und faktenreichen Blick auf ein Geschäftsfeld, das unter dem Label ‚undurchsichtig‘ berühmt geworden ist. Anlass ist die Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach, die weitere Ausbreitung „profitorientierter Arztpraxenketten“ verhindern zu wollen. Alleinstellungsmerkmal dieses Werkes ist der Fokus auf die Frage, wer die Akteure im Konzentrationsprozess sind. Krankenhauskonzerne werden hierbei getrennt von Arztpraxenkonzernen und Private-Equity-Gesellschaften betrachtet und im vierten die Aktivitäten einzelner Vertragsärzt:innen, bzw. BAG offengelegt, die für den MVZ-Markt relevant sind.
Strukturwandel – immer MIT dem Patienten
Deutschland hat im internationalen Vergleich noch ein sehr gutes Gesundheitssystem. Allerdings verspüren viele Patienten, dass der Strukturwandel, vor allem angetrieben durch die demographische Entwicklung, aber auch die Verstädterung, zunehmend den Zugang zu einer umfänglichen medizinischen Versorgung einschränkt. Die gesamtgesellschaftlichen Prozesse stellen das Gesundheitssystem vor große Herausforderungen, da – bekannter Maßen – wenige junge Leute viele ältere Menschen versorgen müssen. Das gilt für die monetäre Seite der Sozialversicherungen, aber auch ganz schlicht, dass zukünftig weniger medizinisches Personal eine steigende Anzahl an Patienten versorgen muss. Dieser Umstand ist den Sozial- und Gesundheitsökonomen schon lange bekannt. Nur haben so groß gewachsenen und stabile Systeme, wie das deutsche Gesundheitswesen, die Eigenschaft recht schwerfällig zu sein, wenn es um Veränderungen geht. Ein Beispiel dafür ist auch der mühsame Weg zur Anstellung von Ärzten und Ärztinnen in der ambulanten Versorgung, so, wie es in den Rubriken Gestern und Heute beschrieben ist.
Von der zunehmenden Verwendung der digitalen Gesundheitsanwendungen, sogenannten DiGa’s, versprechen sich die Experten, dass Patienten teils umfangreicher betreut und damit auch selbstständiger werden. Neue Entwicklungen in diesem Bereich passen die jeweiligen Hilfestellungen der Smartphone Anwendungen z.B. für die Raucherentwöhnung, die Blutzuckerkontrolle oder Depressionsbehandlung an den individuellen Alltag der Personen an.
Gute Ideen – weniger Probleme
Im internationalen Vergleich mit anderen Ländern, gehen Patienten hierzulande sehr häufig zum Arzt. Allerdings sind die Kontakte mit dem Arzt dafür kürzer. Deshalb plädieren viele Experten für eine bessere Patientensteuerung, deren Ziel es ist, dass Patienten beispielsweise nur dann Fachärzte aufsuchen, wenn sie dahin überwiesen wurden. Patienten wären also seltener beim Arzt allerdings mit mehr Zeit. In England praktiziert man bereits das „Gate Keeper Prinzip“, bei dem der Hausarzt als „Torwächter“ für die weiterführende fachärztliche Versorgung der Patienten fungiert. In Deutschland gibt es aber auch Stimmen, die sich dagegen aussprechen, weil sie die freie Arztwahl durch solch ein Konzept in Gefahr sehen. Abseits dieser Diskussion können die digitalen Gesundheitsanwendungen aber durchaus dazu beitragen, zum Beispiel bei chronisch Kranken, die Wartezimmer etwas zu entlasten.
Ein weiteres Problem, das im Übrigen alle vergleichbaren Staaten haben, ist eine rasante Abnahme der medizinischen Versorgung auf dem Land. Die Verstädterung ist ein weitreichendes Problem und, nach Einschätzung glaubwürdiger Prognosen, auch eines, für das es keine einfache Lösung gibt. Für die Patientenversorgung gab und gibt es Modellversuche, die – insbesondere mit der modernen Technik – erfolgsversprechend seien können. Das Klinikum Potsdam hat beispielsweise unter dem Motto „Mobiles MRT für Brandenburg“ (~ mehr dazu) einen LKW mit Anhänger, der durch das Flächenland fährt. Auch das Projekt „MeinMammobil“ verfolgt solch ein Konzept, bei dem ein mobiles Mammographie Gerät, im Kontext der Brustkrebsfrüherkennung, durch Niedersachsen fährt (~ mehr zur Brustkrebsfrüherkennung | ~ mehr zum MeinMammobil). Grundsätzlich ist es denkbar, dass solche Angebote ausgebaut werden. Mit einem ähnlichen Grundgedanken, allerdings schon weiter fortgeschritten, gibt es in anderen Ländern bereits Angebote.
Vertrauen Sie Ihrem Arzt?
Es steht außer Frage, dass solche internationalen Versuche immer an die Kultur und Erwartungen angepasst werden müssen. In Deutschland sind viele Leute noch an einen persönlichen Umgang mit dem ihnen vertrauten Arzt gewöhnt. Solche Interessen werden durchaus auch mitbedacht, denn die hohen Investitionen in solche Projekte sind nur zu rechtfertigen, wenn Patienten das Angebot auch annehmen. Zuweilen wird allerdings leider der Fortschritt auch behindert, mit der Ansicht, „Patienten würden das nicht wollen“, obwohl es für diese Behauptung keine stichhaltigen Belege gibt. So kursiert hierzulande schon lange die Debatte, den Krankenschwestern, medizinischen Fachangestellten und Pflegekräften mehr Befugnisse einzuräumen. Bestimmte medizinische Vorgänge, die heute den Ärzten vorbehalten sind, könnten aber auch von geschultem nicht-ärztlichen Personal vorgenommen werden.
Fachärztinnen und Fachärzte schließen ihre Ausbildung erst nach vielen Jahren ab. Hausärztinnen und Hausärzte brauchen im Durchschnitt etwa 6,5 Jahre für das Medizinstudium und noch einmal 9,5 Jahre für ihre Facharztweiterbildung (~ Quelle). Unter diesem Gesichtspunkt ist es fraglich, ob es sich das deutsche Gesundheitssystem leisten kann, die Zeit von so hochqualifiziertem Personal, dafür einzusetzen, im Auto zu sitzen und übers Land zu den Patienten zu fahren. Alternativ können qualifizierte MFA, wie beispielsweise die NäPa aus dem MVZ Brandenburg, zu ‚Oma Inge‘ fahren, den Blutdruck messen, Blut abnehmen und dann den Arzt über einen Videoanruf kontaktieren, wenn die Voruntersuchung abgeschlossen ist (~ siehe auch Agnes und ihre Schwestern).
Diese zukunftsorientierten Maßnahmen müssen natürlich den Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Dafür braucht es ein gewisses Maß an Mut, Flexibilität und Weitsicht. Ähnlich eines Werkzeugkastens eignen sich bestimmte Werkzeuge gut für Aufgaben, andere überhaupt nicht. Darum scheint es sinnvoll, die zukünftige medizinische Versorgung breit aufzustellen. Damit ist gemeint, dass Praxen, in denen ein Arzt tätig ist, genauso einen wichtigen Platz einnehmen, wie große kooperative Strukturen, wie MVZ, die sich beispielsweise auch Dienstwagen leisten können, mit denen die NäPas oder AGNES Schwestern dann die Patienten besuchen. Auch weitere Kooperationen, mit Angeboten der sozialen Arbeit und Lebenshilfe sind erwägenswerte Modelle. Zurzeit sind solche Kooperationen in den so genannten Primärversorgungszentren und Gesundheitskiosken geplant. Denjenigen, die sich eingängig und ernsthaft damit beschäftigen, das gute deutsche Gesundheitssystem möglichst zu erhalten und den Bürgerinnen und Bürgern weiter zugänglich zu machen, ist allerdings klar, dass wir den Zeitpunkt kleiner Anpassungen schon verpasst haben. Zukünftig müssen wir größere Schritte wagen. Das gilt für Patienten gleichermaßen, wie für Politik und alle im Gesundheitssystem Beschäftigten.